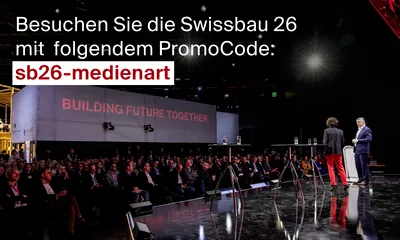Ein Pilotprojekt der Empa zeigt, wie sorptionsverstärkte Katalyse die Effizienz der CO₂-Methanisierung erhöht. Die Technologie könnte helfen, Erdgas fossiler Herkunft zu ersetzen – mit synthetischem Methan aus Luft und Strom.
Redaktionelle Bearbeitung: Phase5
Die Idee klingt simpel, ist technisch aber anspruchsvoll: Aus Strom, Wasser und Kohlendioxid soll ein klimaneutraler Brennstoff entstehen. Der Prozess dahinter ist als Sabatier-Reaktion seit langem bekannt. Doch die Umsetzung im industriellen Massstab stösst an physikalische Grenzen. Hier setzt das Projekt move-MEGA der Empa an.
Im Zentrum steht ein neuartiger Reaktoransatz, bei dem CO₂ und Wasserstoff zu Methan umgewandelt werden – unter Entzug des Reaktionswassers direkt am Katalysator. Die Kombination von katalytischer Reaktion und Sorption steigert die Ausbeute, verbessert die Dynamik und erlaubt eine Reinheit des Produktgases von über 99,95 % Methan.
Systemintegration am Standort Dübendorf
Die Demonstrationsanlage ist Teil des Mobilitätsclusters «move» in Dübendorf. Sie verknüpft Elektrolyse, DAC (Direct Air Capture), Hochtemperaturwärmepumpe und Methanisierung zu einem geschlossenen Power-to-Gas-System. Herzstück ist die zweistufige Methanisierung: In der ersten Stufe wird der grösste Teil des Methans erzeugt, die zweite sorptionsverstärkte Stufe sorgt für die nahezu vollständige Umwandlung der Restgase.
Die Abwärme aus der ersten Reaktion dient gleichzeitig der Regeneration des Sorptionskatalysators – ein intern geschlossener Energiekreislauf, der auf externe Heizquellen verzichtet.
-

Die Methanisierungsanlage verbindet verschiedene Prozesse direkt an einem Standort – das macht sie in dieser Form einzigartig. Foto: Empa -

Die Köpfe hinter der innovativen Methanisierungsanlage der Empa: (v.l.n.r): Jürg Ardüser, Florian Kiefer, Christian Bach. Foto: Marion Nitsch
Vom Labor zur Anwendung: Drei Stufen zur Reife
Das Projekt move-MEGA durchlief drei Phasen entlang der TRL-Skala: Zunächst wurden Grundlagen zur Sorptionskatalyse gelegt und mit bildgebenden Verfahren (u.a. Neutronenstreuung) die Wasserverteilung im Katalysator visualisiert. Danach folgte ein Labordemonstrator mit temperatur- und druckvariabler Betriebsweise. In der dritten Phase wurde eine Demonstrationsanlage mit 50 kW Heizwert realisiert.
Die Entwicklung umfasste auch die Produktion des Katalysators im industriellen Massstab. Mit einem Imprägnierungsverfahren für Zeolithkugeln gelang eine gleichmässige Verteilung aktiver Metalle.
Energie- und Klimabilanz: Grün, aber energieintensiv
Eine Vergleichsstudie zeigt: Die Nutzung von synthetischem Methan reduziert die CO₂-Emissionen um 67 % gegenüber fossilem Erdgas. Allerdings ist der Energiebedarf doppelt so hoch. 90 % des Aufwands entfallen auf die Elektrolyse, zehn Prozent auf die CO₂-Abscheidung.
Die Integration einer Hochtemperaturwärmepumpe zur Nutzung der Elektrolyseabwärme für den DAC-Prozess trägt zur Systemeffizienz bei. Trotzdem bleibt der Wirkungsgrad eine Herausforderung, gerade im Vergleich zu direkter Elektrifizierung.
Forschung mit Anschluss
move-MEGA hat nicht nur eine neue Technologie demonstriert, sondern auch Folgeprojekte angestossen: etwa die Herstellung von Flugkraftstoffen aus CO₂ (Joint Initiative Synthetic Fuels), das SWEET-Projekt reFuel.ch oder die Materialentwicklung für DAC-Systeme (ESCoDAC).
Fazit: Das Projekt zeigt, wie Power-to-Gas technisch umsetzbar ist – unter Einbindung in ein intelligentes Gesamtsystem. Die sorptionsverstärkte Methanisierung könnte ein Baustein der klimaneutralen Energieversorgung werden. Noch sind die Herausforderungen gross, doch das Prinzip ist bewährt und skalierbar.
FAQ
Wie unterscheidet sich sorptionsverstärkte Methanisierung von herkömmlicher? Durch das Abfangen des Reaktionswassers wird das Gleichgewicht der Reaktion verschoben. Das steigert Ausbeute und Reaktionsgeschwindigkeit.
Wie viel CO₂ wird benötigt? Für die Produktion von rund 1 MWh synthetischem Methan werden etwa 220 kg CO₂ benötigt.
Ist die Technologie wirtschaftlich? Noch nicht. Die Anlagen sind komplex und der Energiebedarf hoch. Doch bei weiter sinkenden Strompreisen aus PV oder Wind könnte sich die Technologie lohnen.
Impressum
Textquelle: Empa
Bildquelle: Empa
Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5
Informationen
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: