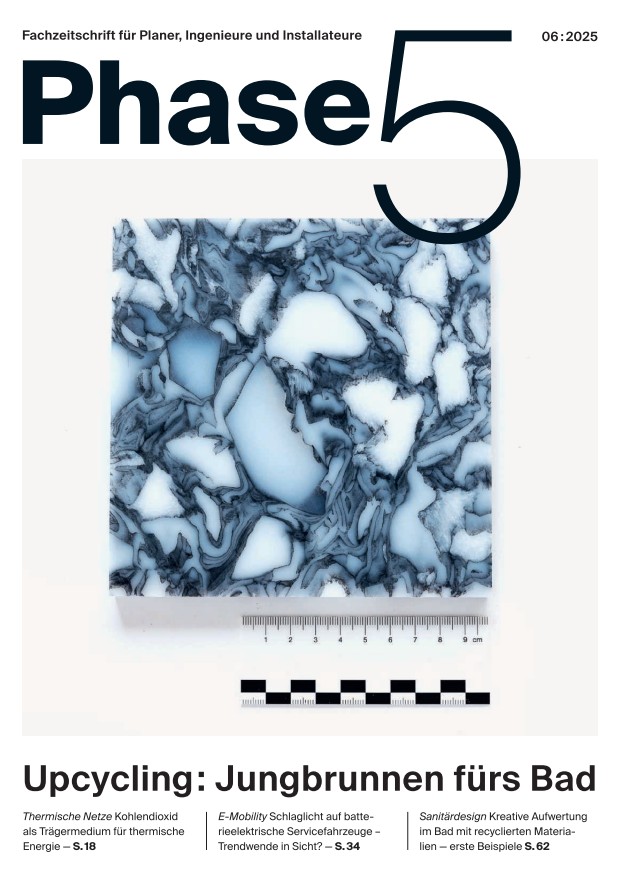Die Kantone wollen Häuser in kleine Kraftwerke verwandeln und ziehen eine gesetzliche Minimalquote für Solaranlagen in Betracht. Die gebäudeintegrierte Photovoltaik beweist, dass ästhetisch hochwertige und technisch ausgereifte Varianten heute schon machbar sind.
Text: Paul Knüsel
Das «grüne Kraftwerk» von Zürich glänzt blau: In Zürich-Altstetten steht seit kurzem ein blau schimmerndes Gebäude, in dem Energie 360°, der öffentliche Gasversorger der Stadt Zürich, residiert, und dort nun selbst Energie produziert. Drei der vier Fassaden sind mit über 1000 Solarmodulen bestückt, deren Glanz die wechselnden Lichtverhältnisse widerspiegeln.
Genauso von der Sonne abhängig ist die lokale Stromproduktion. Gemäss den Planungsprognosen soll die gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlage – auf 2500 m2 grosser Fläche an Fassade und Dach – Strom für etwa die Hälfte der Arbeitsplätze liefern. Wie die Verantwortlichen an der Medienbesichtigung in diesem Frühjahr erklärten, wird die vor Ort erzeugte Energie ebenfalls für die eigene Elektro-Fahrzeugflotte genutzt. Auf dem Betriebsgelände sind 90 Elektroladestationen installiert.
Jörg Wild, CEO von Energie 360°, ist nicht nur stolz auf die Leistung des «grünen Kraftwerks». Ihm gefällt auch die hohe gestalterische Qualität der Photovoltaik. Weil die PV-Module gebändert und halbtransparent sind, erreichen die Sonnenstrahlen auch die Arbeitsplätze in den erneuerten Büros. Die grösste Innovation steckt jedoch hinter der Fassadenverkleidung: Das integrierte PV-System hat in Bezug auf die Brandschutztechnik schweizweiten Pioniercharakter.
Brandschutz-Tests im Prüflabor
Für solare Gebäude, die höher als 11 m sind, gelten seit zwei Jahren neue Sicherheitsregeln. Fassadenelemente müssen verhindern, dass sich ein Feuer über mehr als zwei Stockwerke ausbreiten kann. Kritisch für den Brandschutz sind vor allem die Hohlräume in der Unterkonstruktion, die zur Hinterlüftung und Abkühlung der vorgehängten Solarverkleidungen dienen. Für das Energie-360°-Projekt verlangte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich erstmals überhaupt Vorabtests im Prüflabor. Spezialisierte Einrichtungen gab es in der Schweiz damals nicht, weswegen die Projektbeteiligten nach Deutschland auswichen.
Der Umweg war von Erfolg gekrönt. Die Sicherheitsprüfung wurde bestanden. Zusätzlich erforderlich waren unter anderem horizontal montierte Stahlblechlamellen, die den Rückraum der Fassadenmodule alle zwei Etagen brandsicher abriegeln.
-

Der neu erstellte Verkehrsstützpunkt der Kantonspolizei Graubünden erzeugt Solarstrom, mithilfe von PV-Modulen, die als baulicher Sonnenschutz in die Fassaden integriert sind. (Foto: Faktor Verlag) -

Die Wohnsiedlung Hofwiesenstrasse in Zürich-Nord präsentiert auffällige Solarfassaden. Die PV-Module werden zur Energieproduktion und als Schattenspender für die Laubengänge verwendet. (Foto: Faktor Verlag) -

Gebäudeintegrierte Photovoltaik soll auch gestalterisch üerzeugen. Im Blick die Swisspor-Arena in Luzern. (Foto: zVg)
Potenziell gefährliche Materialien
PV-Fassadenmodule werden von Versicherungen als potenziell gefährlich beurteilt, weil einzelne Materialkomponenten einen Brand beschleunigen oder sogar entfachen können. Tatsächlich sind die Solarzellen vorne und hinten in Glas eingepackt, sodass sie in die Brandklasse RF2 – geringer Brandbeitrag – eingeteilt werden können. Nur reines Glas gilt dagegen als nicht-brennbarer Baustoffe gemäss Klasse RF1. Im Vergleich dazu sind PV-Dachmodule RF3 klassiert; sie sind oft leichter, weil die Rückseite aus einer (brennbaren) Folie besteht.
Zur Minimierung des Brandrisikos von Solarfassaden lassen sich weitere Massnahmen treffen. Unter anderem sind die konstruktiven Verbindungen und Aufhängepunkte punktuell zu verstärken. Zudem wird empfohlen, Elektrokabel in einem nicht brennbaren Metallkanal zu bündeln sowie weitere elektrotechnische Komponenten wie Leistungsoptimierer und Wechselrichter räumlich gesondert zu installieren.
Zwar zeigt eine Planungshilfe des Fachverbands Swissolar auf, mit welchen Massnahmen der Brandschutz für hinterlüftete Photovoltaikanlagen an Fassaden sichergestellt werden kann. Aber die Vereinigung der kantonalen Feuerversicherungen rät auf jeden Fall, das Bewilligungsgesuch mit einem Nachweisverfahren zu ergänzen. Dazu gehören praktische Brandtests an Fassaden-Mockups. Mittlerweile können diese in der Schweiz durchgeführt werden.
Starr oder beweglich
Sicherheitstechnisch weniger problematisch sind fensterlose Aussenwände, weil dort kein Feuer von aussen nach innen eindringen oder umgekehrt sich von innen nach aussen ausbreiten kann. Ein aktueller architektonischer PV-Trend setzt dagegen auf weitere Vereinfachungen: Solarmodule werden an der Fassade multifunktional eingesetzt; die Bauteile nutzen die Sonnenergie nutzen und schützen gleichzeitig vor Sonnenlicht. In Form von Vordächern beschatten sie Fenster und ersetzen meistens den aussenliegenden Sonnenschutz. Solche PV-Systeme sind meistens starr, weshalb sie das Gebäudeinnere vor allem bei hohem Sonnenstand abschirmen. Bisweilen werden der Neigungswinkel und weitere geometrische Parameter mit thermischen Simulationen evaluiert, um die Zusatzwirkung als sommerlichen Wärmeschutz für Wohn- und Bürogebäude zu optimieren.
Das ETH-Spinoffunternehmen «Solskin» präsentiert derweil ein bewegliches PV-Fassadensystem, das seinerseits Energieproduktion und Verschattung kombiniert. Kleine Solarplatten hängen an einem Netz und folgen dem Lauf der Sonne. Abhängig von der Tageszeit optimiert eine intelligente Steuerung die Ausrichtung der Module und bestimmt, ob mehr Schatten als Energieertrag erwünscht ist. Der Prototyp wird am Forschungsgebäude NEST der Empa erprobt.
Vertikale Ergänzung
PV-Module an Fassaden sind in der Regel ein energetischer Gewinn. Obwohl sie weniger Höchstleistung bieten als ein Solardach, machen sie sich anderweitig unerlässlich. Die vertikale Energieproduktion funktioniert insbesondere bei tiefem Sonnenstand optimal, weshalb der gebäudespezifische Solarertrag im Tagesgang und Jahresverlauf mit folgendem Muster ergänzt werden kann: PV-Fassaden erzeugen morgens und abends respektive im Winterhalbjahr mehr Strom als flach geneigte Solardächer.
Und das Blendrisiko?
Die öffentliche Hand fördert PV-Anlagen an Fassaden oder mit steiler Dachaufständerung besonders. Weil damit die Winterausbeute und die tägliche Eigenstromversorgung erhöht werden kann, erhalten PV-Konstruktionen ab einem Neigungswinkel von 75° einen Bonus auf die Förderbeiträge. Zudem soll das Bewilligungsverfahren für Solarfassaden schweizweit vereinfacht werden. Anstelle eines Gesuchs würde eine Meldung an das kommunale Bauamt genügen; für Dachanlagen sind analoge Schnellverfahren bereits üblich. Gesetzliche Auflagen müssen die PV-Gebäudeanlagen weiterhin erfüllen, wie zum Beispiel Brandschutzanforderungen oder Vorgaben, dass keine störenden Emissionen verursacht werden.
Abklärungsbedarf gibt es zum Beispiel beim Blendrisiko. Tatsächlich dürfen homogene Solarfassaden ebenso wie Glasflächen oder Metallverkleidungen keine übermässigen Lichtimmissionen erzeugen. Wie gross ist die Gefahr, dass gut einsehbare, vertikale Solaranlagen die Nachbarschaft stören?
Fachleute geben Entwarnung
Aus Fachkreisen kommt eine generelle Entwarnung. Heute schon blenden PV-Anlagen nur in Ausnahmefällen, bestätigt Christof Bucher, Professor für PV-Systeme Berner Fachhochschule. Für Solarfassaden gelte sowieso: Aus geometrischen Gründen kann eine Blendung fast immer ausgeschlossen werden; der Reflektionswinkel von potenziell blendenden Strahlen richtet sich jeweils in den Boden. «Aus demselben Grund stören Fenster praktisch nie», ergänzt Bucher. Ausserdem sind Solarmodule oft blendarm konzipiert und beispielsweise mit einem satinierten Abdeckglas versehen. An dieser Oberfläche streut sich reflektiertes Licht zwar; aber die Strahlen werden ungebündelt weitergeleitet.
Zum Stand der Planungspraxis gehört dennoch, störende Reflexionen von Solarfassaden vorgängig abzuklären. Allgemein gilt: Die künftig zu erstellenden Gebäudekraftwerke sollen weiterhin mit Leistung und Gestaltung glänzen, aber niemanden blenden.
Impressum
Textquelle: Paul Knüsel (Faktor Journalisten)
Bildquelle: Diverse (Luca Rüedi, Energie 360, Faktor Verlag)
Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5
Informationen
Firma
Faktor Journalisten
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: